Es begann leise – mit einem Flug über den Atlantik, einem Handschlag in einem Londoner Café und einer Einladung, die niemand in Westminster erwartet hatte. Nigel Farage, der einstige Architekt des Brexit und langjährige Freund Donald Trumps, stand plötzlich im US-Kongress, nicht als Zuschauer, sondern als Zeuge. Er sprach gegen die Meinungsfreiheitsgesetze seines eigenen Landes, flankiert von Anwälten einer Organisation, die in den Vereinigten Staaten die Axt an ein halbes Jahrhundert reproduktiver Rechte gelegt hatte.
Was sich über Jahre im Verborgenen formte, wächst nun zu einem machtvollen Netzwerk heran – ein transatlantisches Geflecht aus Geld, Glauben und politischem Kalkül. Die Alliance Defending Freedom, einst ein US-amerikanischer Interessenverband mit juristischem Fokus auf Abtreibungsgegner und christlich-fundamentalistische Anliegen, ist längst zu einem politischen Akteur geworden, der in Europa neue Partner sucht – und findet. Ihr ideologischer Kompass zeigt klar nach rechts: ein Evangelikalismus, der die Gleichstellung der Geschlechter als Bedrohung empfindet, queere Lebensentwürfe als „gesellschaftlichen Verfall“ deutet und die Trennung von Kirche und Staat als moralisches Missverständnis betrachtet.
Diese Organisation nennt sich Alliance Defending Freedom – ADF – und sie hat in den USA Geschichte geschrieben. Sie war Mitarchitektin des Sturzes von Roe v. Wade, des Urteils, das seit 1973 das Recht auf Abtreibung verfassungsrechtlich schützte. Heute gilt sie als juristische Speerspitze der christlichen Rechten – strategisch, gut vernetzt, finanzstark. Und nun, da Donald Trump wieder im Weißen Haus sitzt, ist sie auf Expansionskurs. Ihr neues Ziel: Großbritannien. Dort, wo Religion traditionell wenig Einfluss auf Politik hat und die Unterstützung für das Recht auf Abtreibung parteiübergreifend überwältigend ist, arbeitet die ADF daran, ein anderes Amerika zu importieren – eines, in dem Glaube, Politik und Gesetz ununterscheidbar werden.
In Deutschland findet dieses Weltbild Resonanz – insbesondere in der AfD, deren Rhetorik von der „natürlichen Ordnung der Familie“ bis hin zur Verteidigung „christlicher Werte“ wie ein Echo der ADF-Agenda klingt. Offiziell gibt es keine Kooperation, doch inhaltlich und personell verlaufen die Linien deutlich parallel. Über die Wiener Tochterorganisation ADF International ist die Bewegung tief in das Netzwerk europäischer Rechtsparteien eingebettet, von PiS in Polen bis Fidesz in Ungarn – mit Verbindungen zu Thinktanks, die in Brüssel und Budapest Strategiepapiere austauschen und in Wien gemeinsame Seminare abhalten. Namen wie CitizenGo, Demo für Alle und One of Us tauchen dabei immer wieder auf: Organisationen, die als Schnittstellen zwischen religiöser Moralpolitik und rechtspopulistischer Wahlkampftaktik fungieren. Ihre juristischen Berater, Redner und Lobbyisten wechseln regelmäßig zwischen denselben Konferenzen, Parlamenten und Stiftungen. In Deutschland lassen sich Überschneidungen in Lobbyregistern nachweisen, in denen ADF-nahe Juristen und AfD-nahe Aktivisten nebeneinander auftauchen – verbunden durch ein gemeinsames Ziel: gesellschaftliche Liberalisierung zu bremsen, Frauenrechte und sexuelle Selbstbestimmung schrittweise zurückzudrängen, politische Diskurse zu verschieben, bis Autorität wieder als Tugend gilt. Finanziert wird diese Agenda zum Teil aus den USA, aus demselben Spenderumfeld, das Donald Trumps Aufstieg ermöglichte – ein Netzwerk aus Großspendern, evangelikalen Milliardären und Denkfabriken wie der Heritage Foundation, die längst Europa als nächste Front im „Kulturkampf“ begreifen. Was in Polen und Ungarn bereits Realität ist – eine Allianz aus Religion, Nationalismus und Machtstreben – steht in Deutschland noch am Anfang, doch die Vorzeichen sind unübersehbar. Die ADF liefert die juristische Strategie, die AfD den politischen Resonanzraum, und gemeinsam verschieben sie die Grenzlinien zwischen Glauben und Gesetz, bis Demokratie selbst zur Verhandlungssache wird.
In der öffentlichen Wahrnehmung wurde lange verzerrt dargestellt, wer bei den Berliner Treffen der christlich-konservativen Szene tatsächlich den Ton angab. Während US-nahe MAGA-Kanäle oder Medien den Eindruck erweckten, die Bewegung selbst habe hier eine führende Rolle gespielt, zeigen Recherchen und Teilnehmerberichte ein anderes Bild. In Wahrheit war es ADF International, die europäische Tochter der amerikanischen Alliance Defending Freedom, die inhaltlich den Kurs bestimmte – diskret, aber zielgerichtet.
Nach übereinstimmenden Aussagen mehrerer Beteiligter trat die ADF bei diesen Vernetzungstreffen in Berlin als juristischer und ideologischer Motor auf. Ihre Vertreter präsentierten Gutachten, entwarfen Argumentationslinien und lieferten die sprachliche Architektur, mit der Abgeordnete und Lobbygruppen seither öffentlich gegen Sexualaufklärung, reproduktive Rechte und Gleichstellungspolitik argumentieren. Formell trat die Organisation kaum in Erscheinung: Nach außen trugen kirchliche Vereine, familienpolitische Initiativen oder CDU-nahe Arbeitskreise die Verantwortung. Doch inhaltlich, so berichten mehrere Quellen, führten die Juristen der ADF das Wort.
Typisch für die Arbeitsweise dieser Bewegung ist ihr hintergründiger Einfluss. ADF International agierte nicht als Organisator, sondern als unsichtbarer Taktgeber – eine Rolle, die ihr erlaubt, zugleich Einfluss zu nehmen und Distanz zu wahren. So erschienen die Treffen nach außen als innerdeutsche Debatten über Ethik und Familienpolitik, während die Grundstruktur ihrer Argumente auf Strategiepapiere zurückging, die in Wien und Washington entstanden waren.
Das Missverständnis, die MAGA-Bewegung selbst habe diese Berliner Runden mitgeführt, entstand vor allem durch Übernahmen vieler Social Media Meldungen und Medien. In Wahrheit jedoch war die transatlantische Verbindung subtiler: Die amerikanische Ideologie lieferte die Blaupause, die ADF den juristischen Unterbau, und deutsche Akteure wie CDU-nahe Initiativen boten das Forum, in dem diese Narrative politische Anschlussfähigkeit gewannen. Es ist ein Muster, das sich immer wiederholt – Macht durch Einfluss, nicht durch Sichtbarkeit. Während die Schlagzeilen über angebliche MAGA-Einmischung zirkulierten, arbeitete ADF International im Stillen weiter daran, jene moralpolitische Linie zu verfestigen, die in Europa zunehmend Resonanz findet.
Die Methode ist altbekannt: nicht mit Predigten, sondern mit juristischen Hebeln, kultureller Symbolik und gezielten Allianzen. Und mit einem Wort, das so harmlos klingt wie freiheitsversprechend: Free Speech.
Eine Bewegung im Tarnmodus
Offiziell gibt sich die ADF als unparteiische Menschenrechtsorganisation. Ihr britischer Sprecher, Paul Sapper, betont, man arbeite „mit allen großen Parteien“ zusammen. Doch die Spuren führen fast ausschließlich in eine Richtung – zu Reform U.K., der populistischen Partei unter Farage, die seit Trumps Wiederwahl in Umfragen die konservativen Tories überflügelt.
Hinter den Kulissen hat die ADF ihre britische Niederlassung in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut: viermal so viele Mitarbeiter, viermal so viel Geld. Sitzungen mit Parlamentariern, Briefings mit Trump-nahen US-Beamten, geheime Frühstückstreffen mit Vertretern des amerikanischen Außenministeriums – alles mit einem Ziel: Einfluss.
Ein Beispiel dafür spielte sich im März im Old Queen Street Café, unweit des britischen Parlaments, ab. Um 8:15 Uhr öffnete das Lokal ausnahmsweise früher – für ein vertrauliches Treffen zwischen Farage und einem Gesandten der US-Regierung. Die ADF hatte das Treffen arrangiert, vermittelt, begleitet. Themen: Abtreibung, Onlinezensur, die neuen „Buffer Zones“ rund um Kliniken, die Frauen vor Belästigungen schützen sollen.

Für die ADF sind diese Zonen kein Schutzraum, sondern ein Symbol angeblicher Unterdrückung. In ihren juristischen Anträgen spricht sie von einer „Krise der Meinungsfreiheit“. Tatsächlich wurden mehrere ihrer britischen Klienten verurteilt, weil sie vor Kliniken still beteten – Fälle, die die ADF nun strategisch in Szene setzt, um in der Öffentlichkeit das Bild eines moralisch verfolgten Christentums zu zeichnen.
Der britische Hebel
In einem Land, das seine Säkularität fast wie eine Staatsreligion pflegt, ist der Einfluss amerikanischer Evangelikaler zunächst schwer vorstellbar. Doch die ADF hat gelernt, wie man Herzen und Schlagzeilen gewinnt: nicht über Dogmen, sondern über Diskurse.
„Was sich im Vereinigten Königreich entwickelt, ist eine Allianz für freie Rede“, sagt der irische Jurist Lorcán Price, der die ADF-Strategie in Großbritannien leitet. In Interviews spricht er von einer „Koalition enttäuschter Bürger“, die erschüttert sei über die „staatliche Kontrolle“ von Sprache und Meinung. In Wahrheit bündelt diese Koalition disparate Gruppen – Anti-Abtreibungsaktivisten, libertäre Blogger, konservative Katholiken, radikale Free-Speech-Influencer – in einem gemeinsamen Vokabular: Freiheit.

Auf Nachfrage: „Es hat Jahrzehnte gebraucht, doch nun ist der Moment gekommen. Wer verhindern will, dass sich diese politische Linie in Großbritannien endgültig durchsetzt, muss jetzt handeln. Die designierte Premierministerin Liz Truss und ihre möglichen Kabinettsmitglieder Jacob Rees-Mogg und Steve Baker stehen für dieselbe Ideologie, denselben Kreis einflussreicher Denkfabriken und dieselben Geldgeber, die den Kurs der konservativen Politik seit Jahren prägen.“ (Dr. Russel Jackson, Soziologe)
Die Themenwahl ist klug. In einem Jahr, in dem Großbritannien über Onlinehass, Pro-Palästina-Proteste und rechte Hetze zugleich streitet, klingt „Free Speech“ wie ein neutrales Ideal. Doch im Subtext geht es längst um mehr: um die Rückkehr religiöser Normen in die öffentliche Sphäre. Die ADF hat mit dieser Strategie Erfahrung. In den USA hat sie den Kampf um Meinungsfreiheit als Troja-Pferd benutzt, um religiöse Ausnahmen in Gesetzen zu verankern – etwa das Recht, gleichgeschlechtliche Paare nicht zu bedienen, Abtreibungsinformationen zu verweigern oder trans Personen zu diskriminieren.
Seit 2024 umwirbt die ADF gezielt Farages Partei. Zunächst diskret, über juristische Beratung, später über gemeinsame Auftritte. Ihr britischer Erfolg kam, als sie Farage nach Washington brachte – als Star Witness im Justizausschuss des US-Kongresses. Dort saß er neben Price, während beide die „Gefahren europäischer Zensur“ beschworen. Die Einladung war kein Zufall: Sie kam über die ADF, die Farages Interesse übermittelte, den Ausschuss kontaktierte und den Auftritt koordinierte.
Für die Organisation war das ein Durchbruch – die britische Rechte im US-Parlament, flankiert von Anwälten jener Bewegung, die in Amerika das Recht auf Abtreibung gekippt hatte. Seitdem arbeitet die ADF an zwei Fronten: In London führt sie juristische Fälle, in Washington liefert sie der Trump-Regierung Argumentationslinien, die Großbritannien als „feindlich gegenüber christlichen Werten“ darstellen. Laut mehreren Quellen hat sie bereits Dossiers über angebliche Verletzungen der Meinungsfreiheit im Vereinigten Königreich an das US-Außenministerium weitergegeben.
Farage selbst bestreitet jede ideologische Bindung. Auf Nachfrage erklärte er, Reform U.K. spreche „mit allen möglichen Gruppen“. Dass er sich gegen Abtreibung wende, sei „vollkommener Blödsinn“. Doch seine jüngsten Reden erzählen eine andere Geschichte. Im Frühjahr forderte er eine Parlamentsdebatte über die 24-Wochen-Grenze – und bezeichnete sie als „völlig absurd“. Seine Worte klangen fast identisch mit jenen Formulierungen, die amerikanische Anti-Abtreibungsgruppen seit Jahren nutzen, um das Thema Stück für Stück zu verschieben – von einem absoluten Verbot hin zu einer schleichenden Verengung der Fristen.
Der transatlantische Kreislauf
In den USA dient Farage inzwischen als Projektionsfläche der MAGA-Bewegung – ein europäischer Verbündeter, der die Rhetorik des christlichen Nationalismus mit britischem Akzent wiederholt. Als der US-Vizepräsident J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar Großbritannien wegen angeblicher Einschränkungen der Meinungsfreiheit kritisierte, berief er sich direkt auf einen ADF-Mandanten: den Aktivisten Adam Smith-Connor, der wegen stillen Betens vor einer Klinik verurteilt worden war. In London jubelte die ADF: Ein Satz aus dem Weißen Haus, Millionen Klicks auf X, Musk teilte die Rede – ein Propagandamoment, wie ihn die Organisation perfektioniert hat.
Die Erklärung der Organisation ADF International, markierte einen weiteren Schritt in einer transatlantischen Kampagne, die den Fall des Briten Adam Smith-Connor zu einem Symbol der sogenannten „Religionsfreiheit“ erhebt. In dem Beitrag rühmte sich die ADF, die juristische Verteidigung Smith-Connors zu unterstützen und kündigte an, das Urteil im Juli anzufechten.
Der Hintergrund: Smith-Connor war im Oktober von einem britischen Gericht schuldig gesprochen worden, weil er in einer sogenannten Buffer Zone – einem geschützten Bereich rund um eine Abtreibungsklinik – still gebetet hatte. Die Zonen wurden vom Parlament eingeführt, um Patientinnen vor Belästigungen zu schützen. Doch konservative Gruppen, angeführt von der US-amerikanischen Alliance Defending Freedom, sehen darin einen Angriff auf die Meinungsfreiheit.
Für internationale Aufmerksamkeit sorgte die Reaktion aus Washington: US-Vizepräsident J.D. Vance warf den britischen Behörden vor, Christen wegen ihres Glaubens zu kriminalisieren. Die ADF verbreitete seine Worte umgehend über ihre Kanäle – als Beleg dafür, dass ihr Anliegen in den höchsten politischen Kreisen der Trump-Regierung Gehör findet.
Juristisch ist der Fall eindeutig, politisch jedoch hoch aufgeladen. Menschenrechtsorganisationen verweisen darauf, dass die Verurteilung nichts mit Glaubensverfolgung zu tun habe, sondern mit dem Schutz privater Räume vor ideologisch motiviertem Druck. Die ADF hingegen nutzt den Fall gezielt, um in Großbritannien Stimmung gegen die Abtreibungsgesetzgebung zu machen und den Begriff der „Religionsfreiheit“ neu zu definieren – nicht als Schutz religiöser Vielfalt, sondern als politisches Werkzeug zur Durchsetzung konservativer Moralvorstellungen.
Beobachter sehen darin einen strategischen Testlauf: Mit dem Fall Smith-Connor versucht die ADF, ein amerikanisches Narrativ – den Kulturkampf um Religion und Staat – auf Europa zu übertragen. Die Reaktion des Weißen Hauses zeigt, dass diese Strategie Wirkung zeigt: Ein lokales Bußgeldverfahren in England wurde binnen Stunden zu einem internationalen Politikum.
Seitdem hat sie ihre Reichweite auf britische Universitäten und soziale Medien ausgedehnt. Junge Aktivisten verbreiten ADF-Narrative über „christliche Diskriminierung“, während Farage sie mit Begriffen wie „Judeo-Christian heritage“ anreichert – eine Wortwahl, die in den USA zur DNA der christlichen Rechten gehört, in Großbritannien aber jahrzehntelang kaum vorkam.
Als der US-Kongress im Sommer eine Delegation nach London schickte, saß Farage bei der zentralen Gesprächsrunde nicht im Publikum, sondern auf dem Podium. Auch das war ADF-Organisationsarbeit: Sie hatte das Treffen vorbereitet, Abgeordnete gebrieft, Redner ausgewählt. Der Demokrat Jamie Raskin beschrieb die Szene später so: „Ich hatte das klare Gefühl, dass wir dort waren, um Nigel Farage zu helfen – ihn als Helden der freien Rede zu inszenieren.“ Offiziell betont die ADF ihre Unabhängigkeit. Inoffiziell operiert sie unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, wie es Fiona Bruce, ehemalige konservative Abgeordnete und langjährige Kontaktperson der Organisation, kürzlich selbst formulierte: „ADF agiert oft diskret, unter dem Radar.“
Diskret – und effektiv. Im September, nur zwei Tage nach seinem Auftritt im Kongress, eröffnete Farage den Parteitag von Reform U.K. in Birmingham. „Wir sind die Partei des Aufbruchs“, rief er den jubelnden Anhängern zu. Auf den Mützen stand Make Britain Great Again. In seiner Rede wetterte er gegen Migration, hohe Steuern und „die Regierung, die alles tut, um freie Rede online zu zerstören“. Kein Wort zur Abtreibung – aber viel zu „unserer jüdisch-christlichen Kultur“. Während Farage sprach, versammelten sich in London Hunderte beim March for Life, organisiert von einer seiner ADF-nahen Klientinnen. Dieselben Anwälte, die in Washington für Free Speech argumentiert hatten, hielten hier Reden über das Recht auf Leben. Die transatlantische Linie war geschlossen: Was in Amerika begann, hat in Europa einen neuen Resonanzraum gefunden.
In Großbritannien kann das Abtreibungsrecht nicht wie in den USA per Gerichtsurteil gekippt werden – es ist gesetzlich verankert und nur durch das Parlament änderbar. Genau deshalb versucht die ADF, die öffentliche Stimmung zu verschieben, bevor sie das Gesetz angreift. Das Muster ist bekannt: Erst Freiheit, dann Frömmigkeit, dann Gesetz. Es wäre ein Fehler, diese Bewegung als kulturelle Randerscheinung abzutun. Sie ist gut organisiert, international vernetzt, strategisch geduldig – und sie hat in den USA bewiesen, dass sie das politische Klima ganzer Generationen verändern kann.
Großbritannien ist ihr neues Versuchslabor. Und Nigel Farage, der Mann, der einst Europa verließ, um Großbritannien zu „befreien“, ist nun zum Werkzeug einer Bewegung geworden, die aus Amerika zurückkehrt, um nicht nur dasselbe Land von innen neu zu formen.
Investigativer Journalismus braucht Mut, Haltung und auch Deine Unterstützung.
Stärken bitte auch Sie unseren journalistischen Kampf gegen Rechtspopulismus und Menschenrechtsverstöße. Wir möchten uns nicht über eine Bezahlschranke finanzieren, damit jeder unsere Recherchen lesen kann – unabhängig von Einkommen oder Herkunft. Vielen Dank!
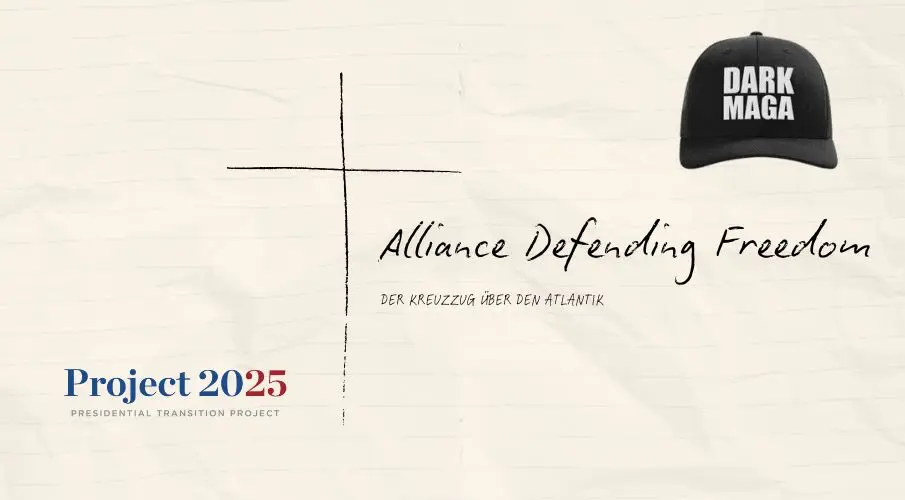

Put, dass die ADF schon so verankert ist, vor allem in der Politik von UK, war mich nicht bewusst.
Danke für diese super Recherche.
Vir einiger Zeit habe ich eine Doku (Arte?) über die Ausbreitung der Evangelikalen in Deutschland gesehen.
Wie sie junge Menschen mit vermeintlich positive n Diskussionen, zu den Predigten und dann in die Evangelikalen Sekte ziehen.
Wie bei Allen Sekten gibt es ein paar charismatische Prediger, die eine wahre Gehirnwäsche vollbringen.
Nur noch das zält, alles Andere ist falsch und zu bekämpfen.
In einigen afrikanischen Staaten läuft es ähnlich.
Da kommen noch Heilungen auf der Bühne dazu.
Wif müssen sehr aufpassen.
Sonst geht es uns, wie in den USA.
Die CDU ist auch ganz tief in der Szene vernetzt, das sollte nicht hinten runter fallen.