Was als architektonische Laune begann, ist längst ein Politikum mit Sprengkraft. Hinter dem Abriss des historischen Ostflügels des Weißen Hauses verbirgt sich keine harmlose Renovierung, sondern ein gewaltiges Finanzierungs- und Machtkonstrukt: Unsere Recherchen im Umfeld der MAGA und Unterlagen, zeichnen ein Bild, in dem sich politische Einflussnahme, wirtschaftliche Interessen und persönliche Eitelkeit auf gefährliche Weise überlappen. Die Kosten des Projekts liegen, anders als offiziell wiederholt genannt, nicht bei 230 Millionen Dollar, sondern bewegen sich nach den uns vorliegenden Kalkulationen im Bereich von 280 bis 300 Millionen Dollar.

Wer zahlt, entscheidet mit. Das Prinzip ist so einfach wie brisant: Anstatt den üblichen Weg über Haushaltsmittel und Kongresskontrolle zu gehen, bat das Weiße Haus Großspender direkt um Schecks. Auf der veröffentlichten Spenderliste finden sich die üblichen republikanischen Großspender, doch auffällig ist die Präsenz von Unternehmen, deren Geschäftsinteressen unmittelbar an Entscheidungen der Administration gekoppelt sind — Telekomfirmen, Schifffahrts- und Eisenbahngesellschaften, Finanzfonds. Und in der Liste fehlen die Namen der Tech-Konzerne nur in Teilen: Google, Apple, Microsoft, Amazon und Meta tauchen, neben vielen anderen bekannten Firmen, überall in Verbindungen auf, und aus internen Briefings geht hervor, dass mehrere dieser Firmen erhebliche Beiträge geleistet haben sollen. Ein bekannter Fall ist YouTube: 22 Millionen Dollar flossen im Rahmen eines Vergleichs.

Die Mechanik ist durchsichtig. Firmen, die um Genehmigungen, Fusionen oder regulatorische Nachsicht buhlen, haben wenig Interesse daran, den Zorn eines Präsidenten zu riskieren, der verfügt, bedroht und öffentlich demütigt. Im Fall von Union Pacific etwa steht eine Milliardenfusion aus, für die ein freundliches Ohr im Weißen Haus Gold wert ist. Für die Tech-Konzerne geht es um Marktzugänge, Infrastrukturrechte und vor allem um künstliche Intelligenz — ein Feld, in dem staatliche Entscheidungen Milliardenentscheidungen bedeuten. Man kann argumentieren, dass Philanthropie Teil der politischen Kultur ist. Doch hier endet die Grauzone und beginnt der offenkundige Interessenkonflikt: Der Präsident bittet die größten Akteure der US-Wirtschaft, seine private Repräsentationshalle zu finanzieren; jene Konzerne, die er reguliert, reagieren mit Zahlungen. Die Treuhandstiftung Trust for the National Mall fungiert dabei als Vermittlerin, sodass die Geldflüsse offiziell nicht direkt an das Weiße Haus gehen. Formal mag alles sauber erscheinen — faktisch schafft die Konstruktion jedoch Abhängigkeiten, die demokratische Kontrolle unterwandern.

Politisch ist der Schaden doppelt: Intern zerrt das Projekt die Administration auseinander, extern nährt es die Erzählung von einer Kaste der Mächtigen, die sich Staatsräson und persönliche Vorlieben erkaufen kann. Mitarbeitende im Finanzministerium wurden Berichten zufolge angewiesen, keine Fotos mehr von der Baustelle zu machen; die Bilder des zerstörten Ostflügels kursieren dennoch, und sie sind nicht nur ästhetischer Verlust, sie sind Symbol. Rechtlich stehen mehrere Fragen im Raum. Wer hat Zugriff auf die Verträge zwischen Spendern und der Treuhand? Welche Zusagen wurden im Gegenzug gemacht? Wurden Aufträge und Bauverträge an Unternehmen vergeben, die Spenden zugesichert hatten? Es sind Fragen, die in einem anderen politischen Klima zu Ermittlungen führen würden. In Washington aber läuft die Debatte bisher auf zwei Ebenen: eine moralische, die Empörung über den offenkundigen Interessenkonflikt artikuliert, und eine strategische, in der Verbündete den Vorgang als legitim und unproblematisch verteidigen.
Hier sind die Unternehmen, die für Trumps Ballsaal im Weißen Haus spenden:
- Altria Group
- Amazon (Amazon-Gründer Jeff Bezos besitzt die Washington Post)
- Apple
- Booz Allen Hamilton
- Caterpillar
- Coinbase
- Comcast Corporation
- Hard Rock International
- Google (22 Millionen Dollar stammen aus einem Vergleich, den Trump mit der zu Google gehörenden Plattform YouTube schloss)
- HP
- Lockheed Martin
- Meta Platforms
- Micron Technology
- Microsoft
- NextEra Energy
- Palantir Technologies
- Ripple
- Reynolds American
- T-Mobile (das Unternehmen erklärte, es habe an den Trust for the National Mall gespendet, aber „keine Rolle bei der Verwendung dieser Mittel“ gespielt)
- Tether America
- Union Pacific Railroad
Was bleibt, ist die Ökonomie der Nähe: Wer dem Präsidenten nahesteht, gewinnt Markt, Aufträge und Gunst; wer sich verweigert, riskiert Repressalien. In diesem Sinne ist der Ballsaal nicht nur ein Raum für Feste. Er ist ein Instrument, mit dem ein Präsident seine Präsenz in Stein, Marmor und Rechnungszeilen verewigt — finanziert von denen, die auf seine Entscheidungen angewiesen sind. Die Demokratie bezahlt den Preis in Form von Vertrauen. Und das ist das eigentliche Problem: Nicht die Farbe des Teppichs, nicht die Größe des Kronleuchters, sondern die Botschaft, die von einem Staat ausgeht, in dem die Lücke zwischen öffentlichem Amt und privatem Vorteil so groß ist, dass sie von Konzernen geschlossen wird. Wenn ein Präsident seine Residenz mit Spenden der Mächtigen versieht, verändert das die Spielregeln. Ob das Gesetz hier greift, ist eine Frage für Juristen. Ob es dem öffentlichen Augenmaß standhält, ist eine Frage für die Bürger.
Investigativer Journalismus braucht Mut, Haltung und auch Deine Unterstützung.
Stärken bitte auch Sie unseren journalistischen Kampf gegen Rechtspopulismus und Menschenrechtsverstöße. Wir möchten uns nicht über eine Bezahlschranke finanzieren, damit jeder unsere Recherchen lesen kann – unabhängig von Einkommen oder Herkunft. Vielen Dank!
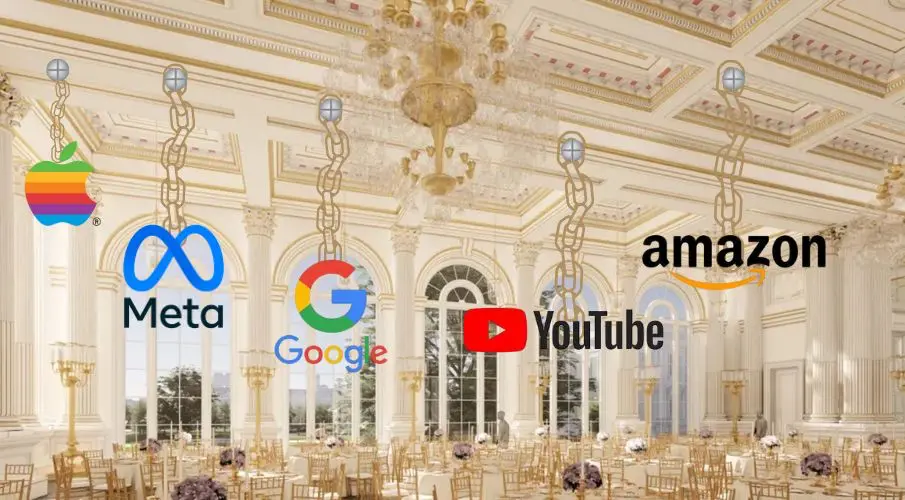

Mit diesem Ballsaal macht er eigentlich fest, dass es keine wirklichen Wahlen mehr geben wird. Denn, bis der Ballsaal fertig ist, ist seine Amtszeit rum…und dann?
..dass kann er vergessen, selbst die variante jd vance als präsidenten zu küren, der dann zurücktritt uhd trump springt ein, ist nicht umsetzbar
Bitte die Quellen nennen, nicht einfach nur die Namen.
Danke für Ihre Nachricht. Sie verwechseln hier investigativen Journalismus mit Agenturjournalismus. Wir sind nicht die, die von anderen übernehmen – wir sind selbst die Quelle oder gehören zu den wenigen Investigativen, die unabhängig zum selben Thema recherchiert haben. Agenturen greifen solche Recherchen später auf oder übernehmen Teile daraus. Genau das ist ja auch Ziel investigativer Arbeit. Entscheidend ist: Das Weiße Haus hat die betreffenden Unternehmen inzwischen selbst bestätigt und eine schriftliche Stellungnahme beziehungsweise eine Liste veröffentlicht. Ich bitte Sie daher, dies zu berücksichtigen – unsere Arbeitsweise hat mit klassischem Agenturjournalismus nichts zu tun, denn wir recherchieren eigenständig.