Wir recherchierten die Gesamtrendite von Aktien in den führenden Industrienationen. Deutschland steht im Vergleich stabiler da – kein schlechtes Bild, sondern das einer überalterten, doch widerstandsfähigen Wirtschaft, die trotz Energiekrisen, zu langsamen Bürokratieabbau, Fachkräftemangel und globaler Unsicherheiten angeschlagen wirkt, aber weit robuster ist, als ihr Ruf vermuten lässt und sich nicht selbst aus dem Tritt gebracht hat. Fehler gibt es, ja, doch keine so systemische Selbstsabotage wie unter Trump.

Berlin sollte nur aufpassen, nicht in das rechtspopulistische Schema der USA zu verfallen. Eine solche politische Verirrung würde unweigerlich zu einem Rückgang von Investitionen, zu wachsender Unsicherheit und zu einer spürbaren Verschlechterung der wirtschaftlichen Stabilität führen. Am Ende träfe es nicht „die Eliten“, sondern die Bevölkerung selbst – mit sinkender Lebensqualität, weniger sozialem Zusammenhalt und einer Gesellschaft, die sich Schritt für Schritt von Vernunft und Verantwortung entfernt. Während Washington Investoren verschreckt und ganze Branchen ausbluten lässt, hält Berlin zumindest an Verlässlichkeit, Sozialpartnerschaft und rechtsstaatlicher Planung fest. Wer in Deutschland eine Politik nach dem Muster der AfD fordern oder kopieren will, sollte genau hinschauen, wohin sie in den Vereinigten Staaten geführt hat: in Entlassungswellen, Isolation und wirtschaftliches Chaos. Das wäre kein Kurs der Erneuerung, sondern ein direkter Weg in dieselbe Katastrophe – ohne Wenn und Aber.
Der Zuwachs des US-Marktes seit Trumps Amtsantritt am 19. Januar 2025 lag bei gerade einmal +13 Prozent. Dabei war es eines der liebsten Argumente des Präsidenten: die angeblich „stärkste Börse der Welt“. Donald Trump verwies bei nahezu jedem öffentlichen Auftritt auf steigende Kurse, sprach von einem „beispiellosen Aufschwung“ und erklärte die Wall Street zum Symbol seiner wirtschaftlichen Genialität. Doch die Zahlen, nüchtern betrachtet, erzählen eine andere Geschichte, nur nicht die von Donald Trump.

Das ist zwar kein Absturz, aber zeigt auf, wie Trumps Politik versagt – vor allem, wenn man sie ins Verhältnis setzt: In Spanien stiegen die Aktienkurse im gleichen Zeitraum um 61 Prozent, in Österreich um 58 Prozent, in Finnland um 45 Prozent, in Irland um 42 Prozent und in Hongkong um 41 Prozent. Selbst Länder mit politischer Instabilität oder begrenztem Binnenmarkt, wie Italien (+39 Prozent) oder Portugal (+35 Prozent), entwickelten sich dynamischer als die Vereinigten Staaten. Damit liegt der US-Markt im internationalen Vergleich nur auf Platz 20 von 22 entwickelten Volkswirtschaften. Lediglich Neuseeland (0 Prozent) und Dänemark (–17 Prozent) schnitten schlechter ab. Auch klassische Stabilitätsmärkte wie Deutschland (+24 Prozent), Japan (+29 Prozent) oder Kanada (+24 Prozent) übertrafen die USA deutlich. Die Behauptung einer „einzigartigen Erfolgsstory“ hält dieser Realität nicht stand.
Zum Vergleich: Noch am 7. November 2024 hatte der S&P 500 im Jahresverlauf um mehr als 25 Prozent zugelegt – eine Dynamik, die unter Trump ein Jahr später deutlich erlahmte.
Ökonomen führen das schwächere Abschneiden der USA auf mehrere Faktoren zurück. Zum einen auf die anhaltende Unsicherheit durch Trumps Zollpolitik, die Exporteure wie Importeure gleichermaßen belastete. Die 2025 neu eingeführten Strafzölle auf EU-Autos, Solarmodule und Stahlprodukte lösten Gegenreaktionen aus, die amerikanische Hersteller empfindlich trafen. Zum anderen sorgte die hohe Volatilität des Dollars infolge wechselnder geldpolitischer Drohungen gegenüber der Federal Reserve für Zurückhaltung internationaler Anleger. Hinzu kamen wiederholte Haushaltskrisen, der temporäre Regierungsstillstand seit Oktober 2025 und die Blockade von Investitionsprogrammen im Infrastrukturbereich – allesamt Bremsklötze für langfristige Kapitalzuflüsse.

Der Traum von den großen Zolleinnahmen ist längst ausgeträumt. Nur einer will es nicht wahrhaben: Zollkaiser Donald Trump
Hinzu kam die klimapolitische Kehrtwende: Die Rücknahme von Förderprogrammen für erneuerbare Energien und Elektromobilität ließ binnen Monaten Projekte im zweistelligen Milliardenbereich scheitern. Die Energiewende wurde in Washington zur Zielscheibe ideologischer Rhetorik – und der Markt reagierte prompt. Investoren zogen sich aus riskanter gewordenen US-Sektoren zurück, während Europa, Kanada und Teile Asiens von klaren Rahmenbedingungen und grünen Wachstumsimpulsen profitierten.

Die Renaissance der Kohlekraft unter Trump stellt einen besonders zynischen Aspekt dieser Umweltzerstörung dar. Neue Kohlekraftwerke werden nicht nur genehmigt, sondern aktiv gefördert – in einer Zeit, in der selbst konservative Ökonomen die wirtschaftliche Unrentabilität dieser Technologie anerkennen. Die gesundheitlichen Folgen sind katastrophal: Jedes neue Kohlekraftwerk bedeutet statistisch gesehen Hunderte zusätzlicher vorzeitiger Todesfälle jährlich durch Feinstaubbelastung, erhöhte Asthmaraten bei Kindern und messbare Intelligenzminderung durch Quecksilberexposition. Die externen Kosten dieser Politik – Gesundheitsschäden, Umweltzerstörung, Klimafolgen – werden auf die Gesellschaft abgewälzt, während die Profite privatisiert werden.
Besonders fatal wirkte Trumps Migrationspolitik, die die Landwirtschaft in weiten Teilen des Landes an den Rand der Funktionsfähigkeit brachte. Millionen saisonaler Arbeitskräfte, auf deren Hände die Ernte angewiesen war, fehlten plötzlich auf den Feldern. Die Folge waren Produktionsrückgänge, Preissteigerungen und der Verlust von Exportanteilen in einem Sektor, der über Jahrzehnte als Rückgrat der ländlichen Wirtschaft galt. Der Mangel an Arbeitskräften griff tief in Lieferketten, Lebensmittelpreise und Konsumstimmung ein – und trug zur allgemeinen Unsicherheit bei, die Investitionen abwürgte.
Während Trump am 9. November 2025 die schwache Börsenentwicklung mit neuen Versprechen überdeckt, stilisiert er seine Zollpolitik zum zentralen Motor eines angeblichen Investitionsbooms. In Reden spricht er von rund 20 Billionen Dollar, die er durch Strafzölle, Steuerkürzungen und persönlichen Druck auf Staats- und Unternehmenschefs angeblich in die USA gelenkt habe. Doch die eigenen Regierungsdaten zeichnen ein anderes Bild: Auf der offiziellen Website des Weißen Hauses sind lediglich 8,9 Billionen Dollar (Stand: 10. November 2025) an Investitionszusagen vermerkt – und selbst diese Summe enthält Zusagen, die noch unter Joe Biden vereinbart oder bereits durch andere Programme finanziert wurden.

Ökonomen bezeichnen Trumps Zahl als stark überhöht, spekulativ und politisch motiviert. Tatsächlich stammen viele der aufgelisteten Projekte – etwa in der Chip-Industrie oder bei Energieunternehmen – aus früheren Förderprogrammen und gelten längst als doppelt erfasst. Selbst die von Trump hervorgehobenen Großinvestitionen aus Japan, Katar oder der Europäischen Union sind bislang weder vertraglich fixiert noch vollständig nachvollziehbar. Besonders auffällig ist der angebliche Beitrag Katars von 1,2 Billionen Dollar, der ein Mehrfaches der jährlichen Wirtschaftsleistung des Landes ausmachen würde. Unsere Recherchen ergaben, dass es sich hier bei um eine reine Absichtserklärung handelt und der Betrag deutlich über der jährlichen Wirtschaftsleistung Katars liegt.

Weiter ergaben unsere Recherchen, dass auch im US-Haushalt, bei SEC-Meldungen oder Investitionsdatenbanken es keine Spur über diesen Betrag gibt. Weder in den Foreign Direct Investment Flows des Bureau of Economic Analysis (BEA) noch in den Treasury International Capital (TIC)-Reports oder in den Securities and Exchange Commission Filings finden sich 2025 Einträge, die auf eine derart hohe Geldbewegung aus Katar in die USA hindeuten würden.

Die Ankündigung erfüllte funktional denselben Zweck wie eine kursrelevante Unternehmensmeldung, allerdings ohne Beleg oder Prospektpflicht. In den USA ist eine derart unbelegte Behauptung durch ein börsennotiertes Unternehmen ein klarer Verstoß gegen SEC-Regel 10b-5, die falsche oder irreführende Angaben mit Einfluss auf Wertpapierpreise verbietet. Für Regierungsmitteilungen gilt diese Vorschrift zwar nicht, doch die Wirkung blieb spürbar: Nach Veröffentlichung des White-House-Fact-Sheets vom 14. Mai 2025 verzeichneten laut Bloomberg und MarketWatch der Infrastruktur-ETF der NYSE einen Anstieg um 1,8 Prozent, der US-Dollar legte gegenüber Euro und Yen zu, und Analysten reagierten kurzfristig optimistisch auf vermeintliche Auslandsinvestitionen. Wenige Tage später, nachdem die Zahl weiter unbelegt war, drehten die Märkte wieder – ein klassisches Beispiel für politisch erzeugte, temporäre Marktbewegungen.
Trotz fehlender Belege hält Trump an der Erzählung eines historischen Investitionsschubs fest, wie er auch immer darauf kommen mag. Seine Sprecher verweisen auf die „disziplinierende Wirkung“ der Zölle und behaupten, die Drohung weiterer Importsteuern zwinge Unternehmen und Regierungen dazu, ihr Kapital in den Vereinigten Staaten anzulegen. Doch bisher zeigt sich in den volkswirtschaftlichen Daten kein Effekt: Der Anteil der Unternehmensinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt stagniert seit Monaten bei rund 14 Prozent, genau wie in der Zeit vor der Pandemie.
Während Europa und Teile Asiens von einem Rohstoff- und Technologiebeschleuniger profitierten – etwa durch neue Lieferketten in Finnland, Irland oder Südkorea –, konzentrierte sich die US-Regierung auf symbolische Gesten: den Rückzug aus Handelsabkommen, die Kürzung von Umweltstandards und den Versuch, über Steuergeschenke an Großunternehmen Wachstum zu erzeugen. Doch diese Politik blieb oberflächlich. Die großen Tech-Konzerne verzeichneten zwar Gewinne, doch der breitere Markt – Industrie, Transport, Energie und Landwirtschaft – stagnierte oder verlor.

Der US-Verkehrssektor ist heute – Stand November 2025 – der größte Emittent von Treibhausgasen im Land. Die Weichenstellungen unter Trump haben viele Fortschritte der vorherigen Jahre zunichtegemacht, und selbst unter Biden konnten sie nur teilweise rückgängig gemacht werden, weil neue Regelungen oft an republikanisch dominierten Gerichten scheitern.
Die fünf führenden Länder der Rangliste spiegeln dagegen Stabilität, Reformfähigkeit und gezielte Förderpolitik wider. Spanien verdankte seinen Aufstieg der Kombination aus Zinserträgen, Infrastrukturprogrammen und einem robusten Bankensektor, der vom europäischen Aufschwung profitierte. Österreichs Kursgewinne trugen das Siegel hoher Dividendenrenditen und einer Energiewirtschaft, die von fossilen Importsubstitutionen profitierte. Finnland wurde durch Technologie und Energieexporte getragen, Irland durch Pharma- und Finanzdienstleistungen, Hongkong durch Zuflüsse aus Festlandchina und den Boom asiatischer Technologiewerte. Die Unterschiede sind strukturell, nicht zufällig.
Die Datenlage ist eindeutig. Weltweit stieg der Aktienindizes im Durchschnitt um knapp 32 Prozent seit Januar 2025. Die Vereinigten Staaten liegen damit deutlich unter dem globalen Schnitt. In realer Kaufkraft, also inflationsbereinigt, beträgt der Zugewinn an der Wall Street sogar nur rund 4,8 Prozent – so niedrig wie zuletzt in den späten 1970er Jahren. Trumps wiederholte Behauptung, seine Präsidentschaft habe den „größten Aktienboom aller Zeiten“ ausgelöst, wirkt vor diesem Hintergrund wie eine Fata Morgana – ein Trugbild, das in der Hitze politischer Selbstinszenierung schimmert, aber bei genauerem Hinsehen zerfällt. Die wahre Dynamik dieser Epoche spielte sich nicht in New York ab, sondern in Madrid, Wien, Helsinki und Dublin – dort, wo politische Stabilität, europäische Förderpolitik und ein klarer Kurs in Energie- und Technologiefragen Investoren Vertrauen gaben.

Die Vereinigten Staaten rutschen in einen selbstverschuldeten wirtschaftlichen Niedergang, angetrieben auch von Trumps aggressiver Migrationspolitik. Was als nationalistische Arbeitsmarktrettung verkauft wurde, entpuppt sich als ökonomischer Sprengsatz. Fabriken, Farmen, Krankenhäuser, Kindergärten und Bauunternehmen verlieren massenhaft Beschäftigte, weil die Regierung jene Menschen vertreibt, die die Wirtschaft überhaupt am Laufen hielten. In der Landwirtschaft verrotten Ernten, in der Pflege fehlen Hände, im Dienstleistungssektor brechen ganze Strukturen weg. Die Folge ist eine Welle von Entlassungen, die längst auch jene erreicht, die glaubten, von Trumps Politik zu profitieren. Seine Abschottung zerstört nicht nur Arbeitsplätze – sie zerfrisst das Fundament der amerikanischen Wirtschaft.
Im Oktober 2025 verzeichneten US-Unternehmen den höchsten Stellenabbau für diesen Monat seit mehr als zwei Jahrzehnten. Nach Angaben der Beratungsfirma Challenger, Gray & Christmas wurden 153.074 Entlassungen angekündigt – mehr als doppelt so viele wie im September und rund 175 Prozent mehr als im Oktober 2024. Damit erlebt der Arbeitsmarkt eine abrupte Wende: Nach Monaten gedämpfter Neueinstellungen ist nun eine beispielose Entlassungswelle da. Besonders betroffen sind große Konzerne wie Amazon, das 14.000 Büroarbeitsplätze streicht, weil künstliche Intelligenz viele Tätigkeiten ersetzt. Experten warnen, die Entlassungen seien ein Warnsignal für die Konjunktur – wieder einmalgetrieben von Trumps Zollpolitik, den Kürzungen im öffentlichen Dienst, dem harten Vorgehen gegen Migranten und einer bremsenden KI-Automatisierung.
Es bleibt der Widerspruch einer Präsidentschaft, die Reichtum versprach und Unsicherheit lieferte. Der amerikanische Aktienmarkt, einst Symbol nationaler Stärke, spiegelt heute die Schwächen eines Systems wider, das sich von kurzfristiger Symbolpolitik leiten lässt. Während Trump in Reden noch immer vom „größten Aufschwung der Menschheitsgeschichte“ spricht, zeigt die Bilanz nüchtern, was ist: Die Welt zog davon – und Amerika blieb zurück.
Methodik und Datenbasis
In der Recherche beziehen wir uns auf die jeweiligen Leitindizes der Länder, also die Hauptbörsenindizes, die den Gesamtmarkt eines Landes am besten abbilden. Konkret:
Alle Werte beziehen sich auf den Zeitraum vom 19. Januar 2025 (Trumps Amtseinführung) bis zum 8. November 2025, auf Basis handelsgewichteter Durchschnittsdaten, u. a. von Bloomberg, MSCI und Refinitiv. Es sind die nationalen Leitindizes; Dividenden und Wechselkurseffekte wurden in der Vergleichsrechnung berücksichtigt.
Investigativer Journalismus braucht Mut, Haltung und auch Deine Unterstützung.
Stärken bitte auch Sie unseren journalistischen Kampf gegen Rechtspopulismus und Menschenrechtsverstöße. Wir möchten uns nicht über eine Bezahlschranke finanzieren, damit jeder unsere Recherchen lesen kann – unabhängig von Einkommen oder Herkunft. Vielen Dank!
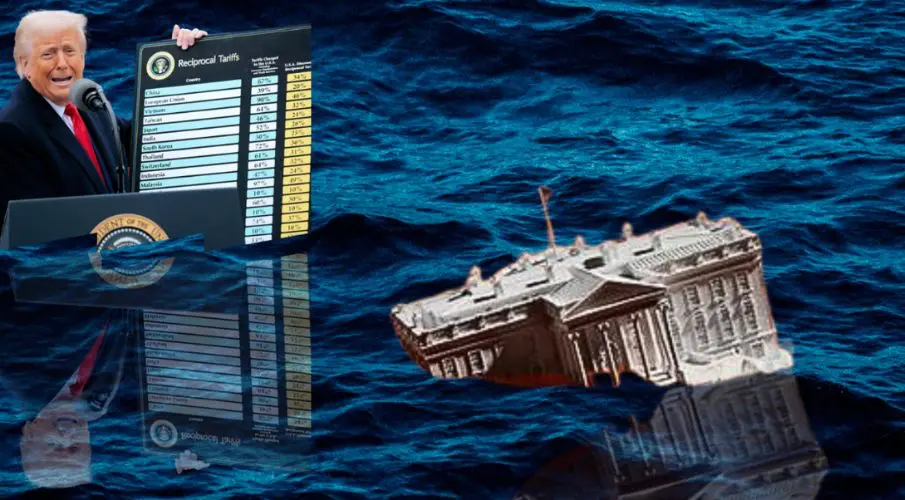

Ein super Recherche. Danke
Vielen dank
Wow, danke für diese umfangreiche Recherche.
Es zeigt wie Trump auch seine Geschäfte gefûhrt hat. Und zwar mehrfach in die Insolvenz.
Er blast alles auf, verteilt Nebelkerzen, erfindet Positiv-Zahlen.
Nur der Blick dahinter offenbart den Bluff.
Derzeit ist es für mich ein hochgepokerter Bluff von Trump.
Einige lassen sich blenden und gehen „auf Knien“ Deals ein.
Ich hoffe, dass Europa, bzw Deutschland sich nicht in diesen Sog ziehen lassen.
Sondern solide und stabile (Wirtschafts) Politik macht.
Weg vom Kniefall und anbiedern an Autokraten ( wie gerade neu von Merz mit Erdogan), hin zur Eigenständigkeit ohne extrem rechte oder extrem linke Ideologie.
Politik mit und für die Bevölkerung, nicht gegen sie
danke dir, europa braucht nicht trump so sehr, wie trump europa, das muss einfach in bruessel ankommen