In einem sterilen Konferenzraum des Memorial Sloan Kettering Cancer Center sitzt Dr. Ira Dunkel an einem Dienstagmorgen im August und starrt auf seinen Bildschirm. Die E-Mail, die er gerade gelesen hat, enthält nur wenige Zeilen, doch sie wiegen schwerer als die dicksten medizinischen Fachbücher in seinem Regal. Das Pediatric Brain Tumor Consortium, sein Lebenswerk, das Lebenswerk so vieler, wird sterben. Nicht sofort, nicht dramatisch, sondern langsam, bürokratisch, leise – so wie man in Washington Träume beerdigt.

Sechsundzwanzig Jahre. So lange hat das Netzwerk existiert, seit 1999, als die Welt noch an Y2K glaubte und niemand ahnte, dass man eines Tages CAR-T-Zellen programmieren könnte, um Tumore zu jagen wie mikroskopische Bluthunde. Sechsundzwanzig Jahre, in denen Ärzte und Forscher an sechzehn der renommiertesten Krankenhäuser Amerikas eine unsichtbare Brücke bauten – eine Brücke zwischen dem Heute der Verzweiflung und dem Morgen der Heilung. Vier Millionen Dollar jährlich. Im Kontext der amerikanischen Verteidigungsausgaben nicht einmal ein Rundungsfehler. Weniger als der Preis eines einzigen Kampfhubschraubers. Aber für Familien, deren Kinder mit Ependymomen kämpfen, mit Glioblastomen, mit all den grausamen Varianten kindlicher Hirntumore, waren diese vier Millionen Dollar das Äquivalent ganzer Universen der Hoffnung.
Die Arithmetik des Abschieds
Dr. Meenakshi Hegde in Houston hat zwanzig kleine Patienten in ihrer CAR-T-Zell-Studie. Zwanzig Kinder, deren Immunsystem sie zu einer Armee umschulen will, die den Feind im eigenen Kopf bekämpft. Einige haben ihre modifizierten Zellen noch nicht erhalten, schweben in diesem merkwürdigen Limbus zwischen Diagnose und Therapie. Sie wird ihnen bald erklären müssen – oder ihren Eltern, denn viele sind zu jung, um zu verstehen –, dass die Zukunft plötzlich unsicherer geworden ist. Nicht weil die Wissenschaft versagt hat, sondern weil irgendwo in den Marmorkorridoren der Macht jemand entschieden hat, dass „Ressourcen für maximale Wirkung optimiert“ werden müssen.
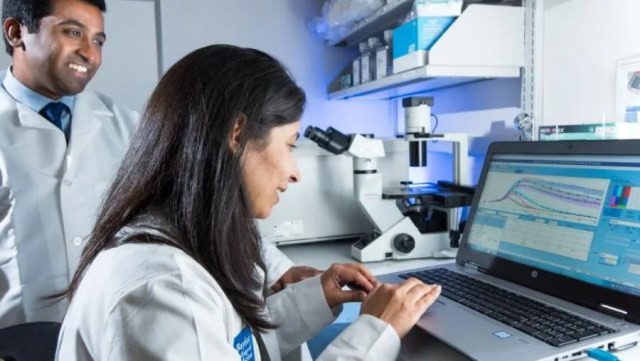
Diese Phrase, kalt und technokratisch, erschien am 21. August auf der Website des National Cancer Institute. Keine Pressekonferenz, keine öffentliche Debatte, nur eine Textänderung auf einer Webseite, die kaum jemand liest. So stirbt Innovation im 21. Jahrhundert – nicht mit einem Knall, sondern mit einem Update. Dr. Mark Souweidane hatte zwei Jahre lang an seiner Studie gearbeitet. Zwei Jahre der Begutachtung, der Revision, der akribischen Planung. Seine Vision: Ein Laser, der durch winzige Öffnungen navigiert wird, um Tumore zu erhitzen und zu zerstören, ohne das gesunde Gewebe drumherum zu verletzen. Weniger invasiv als traditionelle Chirurgie, kürzere Krankenhausaufenthalte, weniger Trauma für Körper, die bereits zu viel durchgemacht haben. Die Studie stand kurz vor dem Start. Jetzt liegt sie auf Eis, vielleicht für immer.

„Was man nicht messen kann“, sagt Souweidane, und seine Stimme trägt die Müdigkeit von jemandem, der zu oft gegen Windmühlen gekämpft hat, „ist der Ideenaustausch, die Zusammenarbeit, das gegenseitige Befruchten von Gedanken.“ Er spricht von etwas, das keine Excel-Tabelle erfassen kann: von den Momenten in Kaffeepausen bei Konferenzen, wenn ein beiläufiger Kommentar plötzlich eine neue Forschungsrichtung eröffnet. Von den nächtlichen Telefonaten zwischen Kollegen in Seattle und Boston, die gemeinsam über einen besonders schwierigen Fall brüten. Von dem unsichtbaren Gewebe der Hoffnung, das sich über Jahre hinweg zwischen diesen sechzehn Institutionen gesponnen hat.
Die Kinder auf der Warteliste
Irgendwo in Amerika sitzt heute Abend eine Mutter am Bett ihres Kindes. Das Kind schläft unruhig, die Medikamente gegen die Kopfschmerzen machen müde, aber der Schlaf will nicht richtig kommen. Die Mutter hält einen Ausdruck in der Hand, eine E-Mail von der Klinik. Ihr Kind stand auf der Warteliste für eine der PBTC-Studien. Stand – Vergangenheit. Jetzt ist alles in der Schwebe. Sie versteht die großen Zusammenhänge nicht, die Politik, die Budgetkürzungen durch Trumps Regierung, die Prioritätenverschiebungen in Washington. Sie versteht nur, dass die Tür, die einen Spalt offen stand, sich nun zu schließen droht. Dass die experimentelle Therapie, die vielleicht, nur vielleicht, ihrem Kind helfen könnte, plötzlich unerreichbar scheint.
Dr. John Prensner von der University of Michigan, der das Konsortium von außen beobachtet hat, wählt seine Worte sorgfältig, wenn er über die Patienten spricht: „Höchstrisikobehaftete Tumore.“ Ein klinischer Begriff, der die Realität verschleiert – Kinder, die bereits alles versucht haben, bei denen die Standardtherapien versagt haben, deren Überlebenschancen sich in einstelligen Prozentsätzen messen. Für sie sind diese frühen klinischen Studien nicht nur Wissenschaft. Sie sind die letzte Station vor der Kapitulation.

Das Grausame an der Entscheidung ist ihre Timing. Die Trump-Administration hat die Mittel der National Institutes of Health gekürzt, aber niemand will offiziell bestätigen, ob dies der Grund für das Ende des PBTC ist. Es ist einfacher, von „Optimierung“ zu sprechen, von „Konsolidierung“, von all den Wörtern, die Bürokraten verwenden, wenn sie nicht sagen wollen, dass das Geld fehlt. Das National Cancer Institute verspricht, man werde versuchen, einige Studien in das größere Pediatric Early Phase Clinical Trials Network zu überführen. Aber selbst Dr. Dunkel, der verzweifelt nach Lösungen sucht, gibt zu: „Es wird keine nahtlose Übergabe sein.“ Wochen, vielleicht Monate werden vergehen. Für Erwachsene mit Krebs wären das schwierige Wochen. Für Kinder mit aggressiven Hirntumoren kann es der Unterschied zwischen Leben und Tod sein. Dr. Douglas Hawkins vom Seattle Children’s Hospital formuliert die Befürchtung, die alle teilen, aber nur wenige aussprechen: „Das Risiko ist, dass wir am Ende weniger relevante klinische Studien für pädiatrische Hirntumoren durchführen.“ Weniger Studien bedeutet weniger Chancen. Weniger Chancen bedeutet mehr Kinder, die sterben werden.

Die sechs aktiven Studien des PBTC laufen weiter, vorerst. Die bereits eingeschlossenen Patienten dürfen ihre Behandlung fortsetzen. „Es wäre katastrophal“, sagt Dunkel, „wenn wir sagen müssten: ‚Es tut uns leid, aber die Behandlung kann nicht fortgesetzt werden.'“ Doch die Uhr tickt. März 2026 – dann ist endgültig Schluss. In den Laboren und Kliniken des Konsortiums herrscht eine merkwürdige Stimmung. Die Arbeit geht weiter, Proben werden analysiert, Daten ausgewertet, Berichte geschrieben. Aber es ist die Arbeit von Menschen, die wissen, dass ihre Zeit abläuft. Wie Musiker auf der Titanic spielen sie weiter, während das Schiff sinkt.
Was verloren geht, ist mehr als nur ein Forschungsnetzwerk. Es ist ein Stück amerikanischer Wissenschaftstradition – die Überzeugung, dass man die schwierigsten Probleme gemeinsam lösen kann, dass Zusammenarbeit stärker ist als Konkurrenz, dass die Heilung eines einzigen Kindes die Investition von Millionen rechtfertigt.

In seinem Büro im Memorial Sloan Kettering schaut Dr. Dunkel aus dem Fenster auf die Skyline von Manhattan. Irgendwo da draußen, in einem der zahllosen Krankenhäuser dieser Stadt, liegt vielleicht ein Kind, das von der Arbeit des PBTC hätte profitieren können. Ein Kind, dessen Name er nie erfahren wird, dessen Geschichte ungeschrieben bleiben wird. Die E-Mail auf seinem Bildschirm ist noch offen. Keine schriftliche Kommunikation von der Leitung des National Cancer Institute, nur die mündliche Nachricht vom 19. August. Als würde man sich schämen für diese Entscheidung, als wollte man keine Spuren hinterlassen. Sechsundzwanzig Jahre Arbeit, beendet mit einem Telefonat und einer aktualisierten Webseite.

Draußen geht die Sonne unter über Manhattan. In den Krankenhäusern des Pediatric Brain Tumor Consortium bereiten sich Ärzte auf ihre Nachtschichten vor. Sie werden weiterarbeiten, weiter hoffen, weiter kämpfen. Aber sie wissen, dass der Countdown begonnen hat. Sieben Monate noch. Dann erlischt ein Licht in der Dunkelheit kindlicher Krebserkrankungen. Leise, bürokratisch, endgültig.
Investigativer Journalismus braucht Mut, Haltung und auch Deine Unterstützung.

Es ist zum Heulen!
ja, das ist so schlimm, und das sind unsere recherchen, nicht die flecken auf der hand nummern mit trump und dollsten spekulationen…das hier, das ist richtig wichtig
Du hast so Recht. Wem nützt ei Fleck auf der Hand des Teufels? Aber die realen Auswirkungen der Abkehr von jeglicher Empathie, die Unmenschlichkeit im neuen Amerika, die fühlen die Menschen täglich. Es ist zum wahnsinnig werden.
…wir meinen damit, wir sind investigative journalisten, nicht adels-reporter, was in amerika los ist, sehen wir täglich und kämpfen mit allem was geht dagegen an.
4 Millionen… an 4 lächerlichen Millionen scheitert ein derart wichtiges Programm?
2 Wochenenden die Trump nicht in Washington DC verbringt sondern nach Mar a Lago einfliegt.
Dieser Mann will in den Himmel?
Dieser Mann ist entsetzt, was den Kindern in der Unkraine passiert?
Melania sollte mal einen Brief an ihren Mann schreiben.
Aber das ist ja nicht so medienwirksam.
Pro-Life Party.
Ja, für ungeborenes Leben wird, gegen due Mutter, bis aufs Blut gekämpft.
Aber kaum sind die Kinder auf der Welt, interessiert sich die republikanische Partei bicht mehr.
Da ist alles Gottes Wille und Beten hilft.
Es ist einfach so grausam
diese recherche war auch für uns, wie die russland-recherche kinder echt hart und geht nicht spurlos vorbei
Ela Gatto, Rainer Hoffman,
Ev könnten private Geldgeber für diese 4 Mio gefunden werden….sowieso wäre es gut, wenn solche Projekte schon wegen ihrer Einzigartigkeit mehr über private Geldgeber finanziert würden. Es ist nicht gut, wenn der Staat so übermächtig ist und solch kleine, aber überaus wichtige Projekte einfach abschiessen kann durch Wegnahme der Finanzen.
Fundraising ist das Zauberwort, darüber müssten sich diese Kleinprojekte aktivieren.